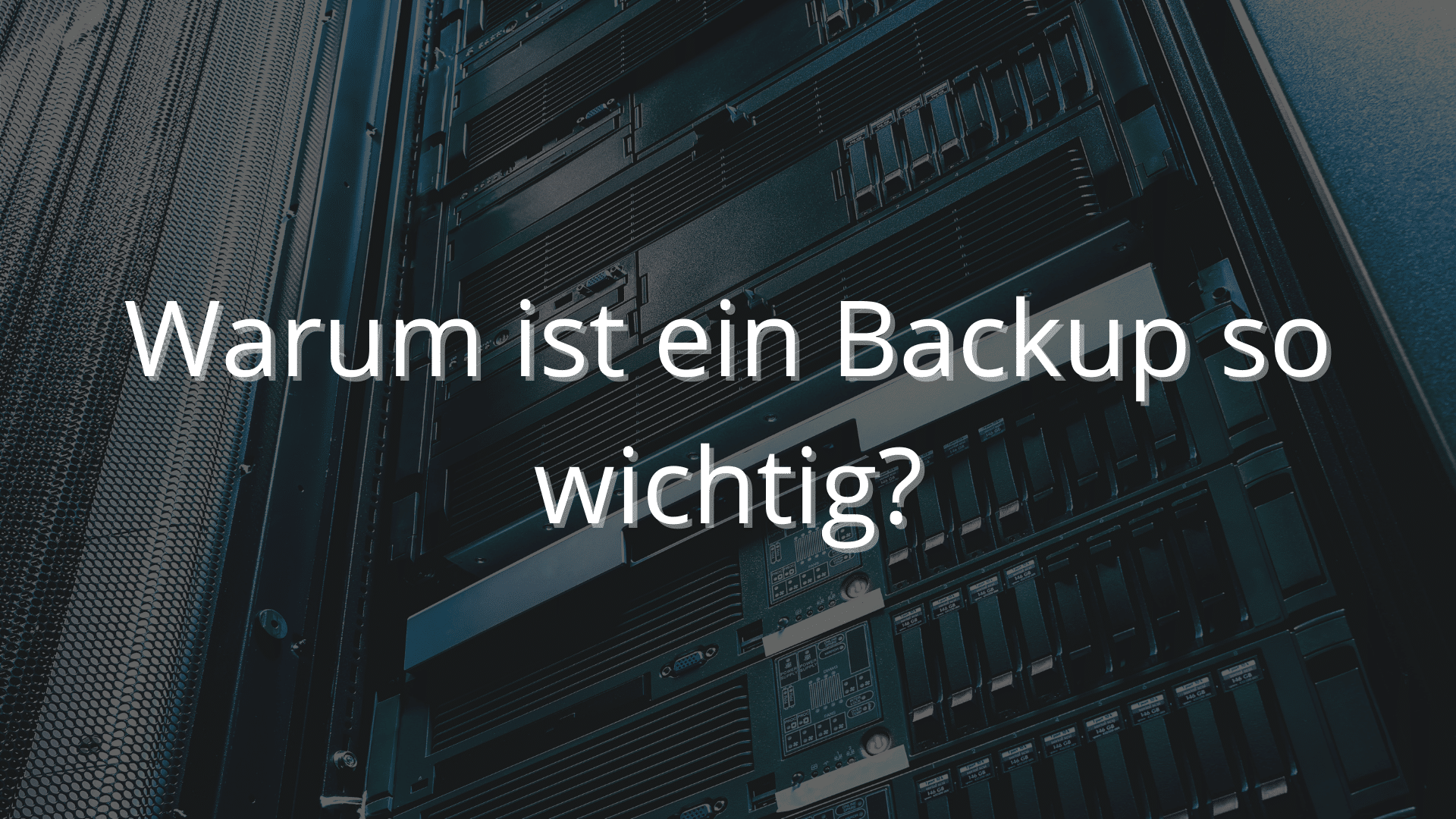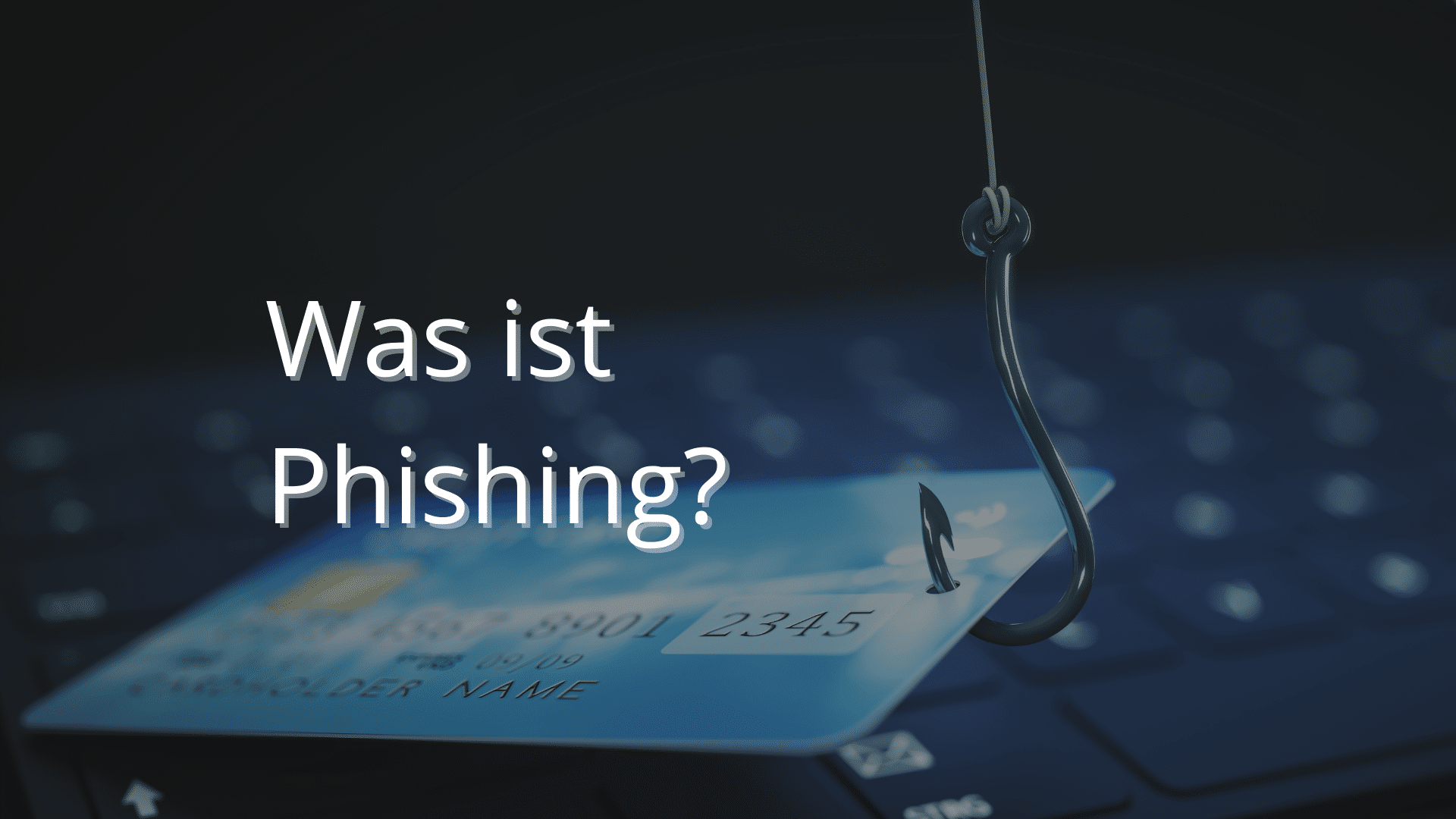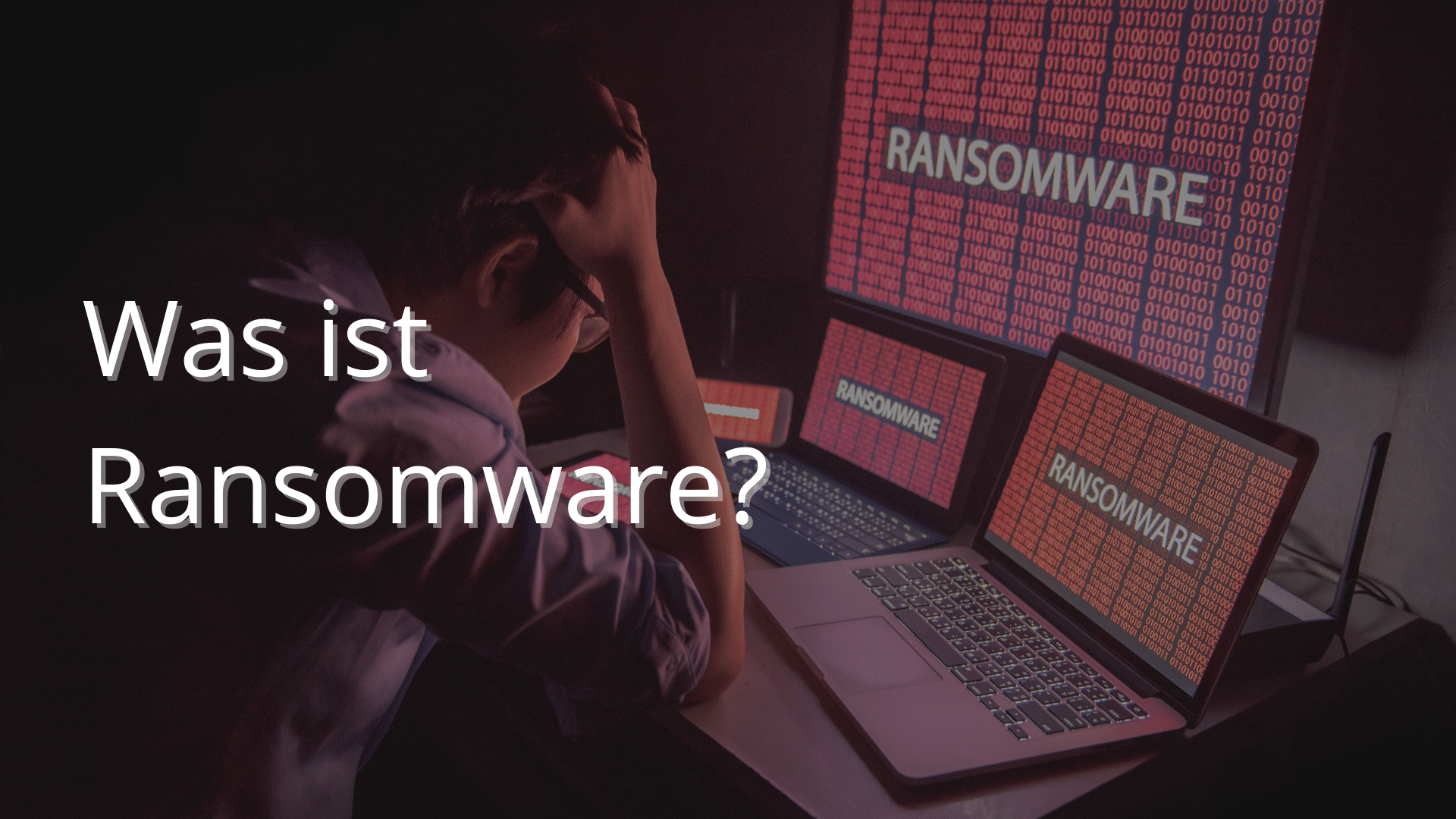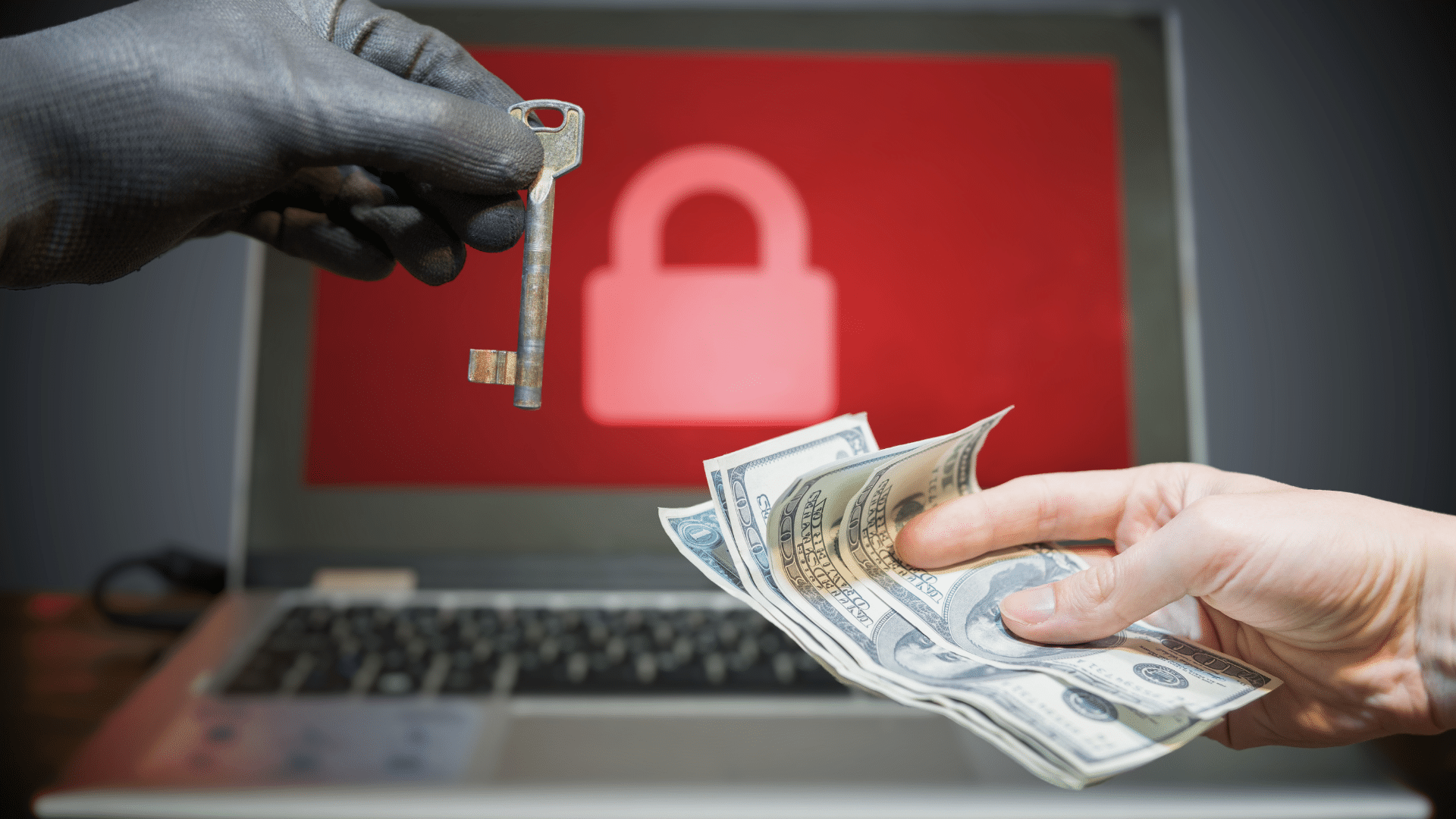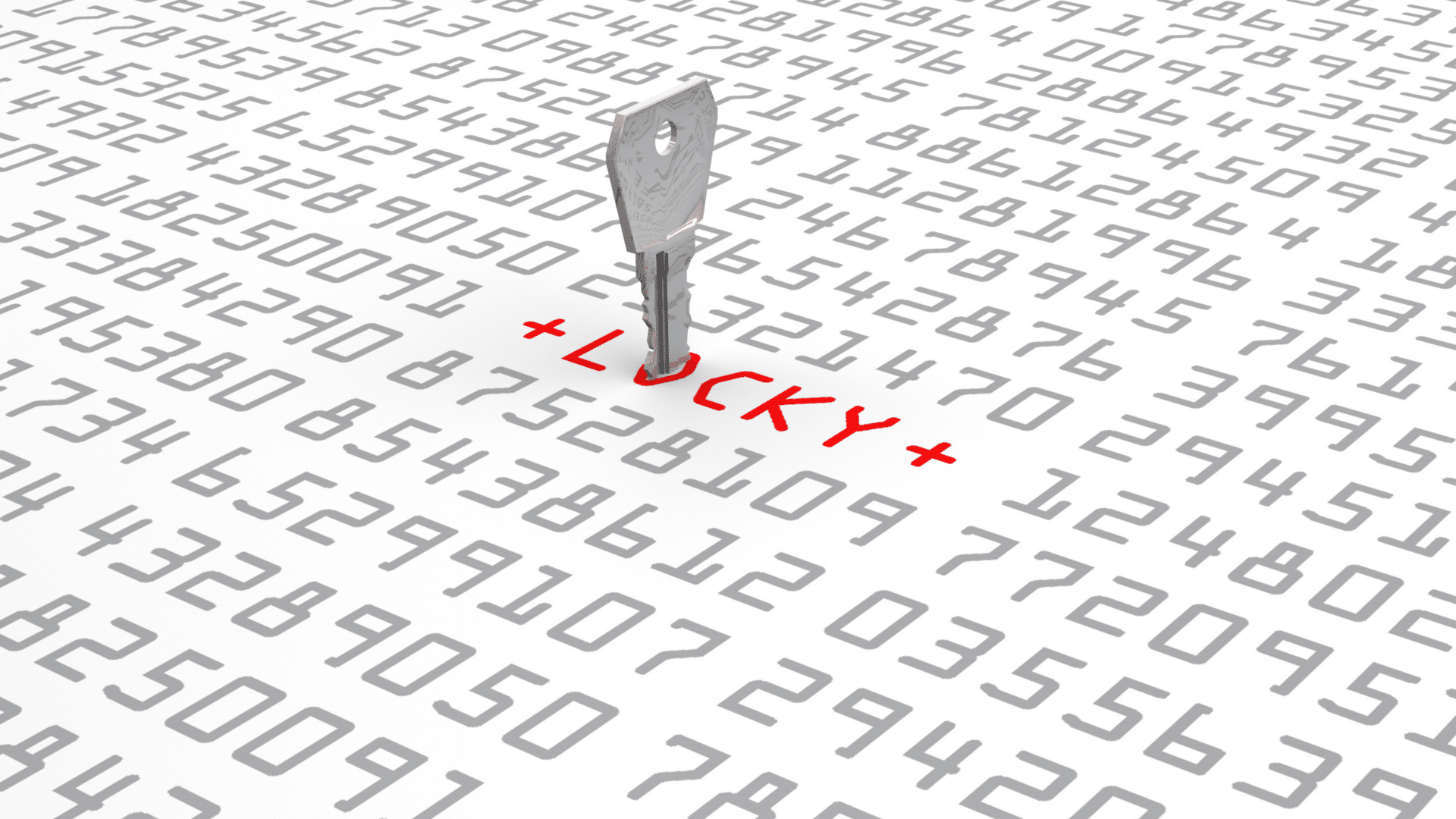Was würden Sie tun, wenn Ihr Unternehmen morgen von einem Ransomware-Angriff betroffen wäre? Haben Sie einen Notfallplan für den Fall eines Tornados, Hurrikans oder Erdbebens? Das Unerwartete kann jederzeit eintreten, und kleine Unternehmen können besonders hart getroffen werden.
Kleine Unternehmen sind das Rückgrat vieler Volkswirtschaften. Sie sind entscheidend für die Schaffung von Arbeitsplätzen, Innovation und die Entwicklung der Gemeinschaft. Die Führung eines Kleinunternehmens ist jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu gehören finanzielle Unsicherheit, Marktvolatilität und Naturkatastrophen.
60 % der kleinen Unternehmen scheitern innerhalb von 6 Monaten, nachdem sie Opfer eines Cyberangriffs geworden sind.
Kleinunternehmer müssen sich daher auf das Unerwartete vorbereiten. Nur so können sie ihre Zukunftsfähigkeit und ihren Erfolg sichern. In diesem Artikel werden wir einige Tipps erörtern, die kleinen Unternehmen bei der Krisenprävention helfen.
1. Erstellen Sie einen Notfallplan
Einer der wichtigsten Schritte bei der Vorbereitung auf das Unerwartete ist die Erstellung eines Notfallplans. Ein Notfallplan ist eine Reihe von Verfahren, die einem Unternehmen helfen, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Dazu gehören Naturkatastrophen, Unterbrechungen der Lieferkette oder unerwartete finanzielle Rückschläge.
Der Plan sollte die Schritte beschreiben, die das Unternehmen in einem Notfall unternehmen wird. Dazu gehört auch die Frage, wer für welche Aufgaben zuständig sein wird. Und wie mit Mitarbeitenden, Kund*innen und Lieferanten kommuniziert werden soll.
2. Angemessenen Versicherungsschutz gewährleisten
Kleine Unternehmen sollten stets über einen angemessenen Versicherungsschutz verfügen. Dies schützt sie vor unerwarteten Ereignissen. Die Versicherungspolicen sollten u. a. Folgendes umfassen:
- Haftpflichtversicherung
- Deckung von Sachschäden
- Versicherung gegen Betriebsunterbrechung
- Kosten für Datenverletzungen
Die Betriebsunterbrechungsversicherung ist besonders wichtig. Sie kann dazu beitragen, Einkommensverluste und Ausgaben während einer Unterbrechung zu decken. Zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder einer Unterbrechung der Lieferkette.
Eine der neueren Arten von Policen ist die Cybersecurity-Haftpflichtversicherung. In der heutigen Bedrohungslandschaft ist sie zu einer wichtigen Absicherung geworden. Die Cybersecurity-Versicherung deckt u. a. die Kosten für die Behebung einer Sicherheitsverletzung und Rechtskosten ab.
3. Diversifizieren Sie Ihre Einnahmeströme
Kleine Unternehmen, die sich auf ein einziges Produkt oder eine einzige Dienstleistung verlassen, sind einem größeren Risiko ausgesetzt. Unerwartete Ereignisse können ihnen erheblichen Schaden zufügen. Ein Rohstoffmangel beispielsweise könnte ein Unternehmen ohne Alternativen lahmlegen.
Die Diversifizierung Ihrer Einnahmequellen kann dazu beitragen, dieses Risiko zu verringern. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Unternehmen über mehrere Einnahmequellen verfügt. Ein Restaurant kann zum Beispiel Catering-Dienste anbieten. Ein Bekleidungsgeschäft kann seine Waren sowohl online als auch an seinem Standort verkaufen.
4. Starke Beziehungen zu den Zulieferern aufbauen
Kleine Unternehmen sollten enge Beziehungen zu ihren Lieferanten aufbauen. Dadurch wird sichergestellt, dass sie über eine zuverlässige Lieferkette verfügen. Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, die bei der Lieferung ihrer Produkte von einem einzigen Lieferanten abhängig sind.
Im Falle einer Unterbrechung ist es wichtig, gute Beziehungen zu haben. Sie mindern das Risiko eines Lieferantenkonkurses oder eines Lieferkettenproblems. Wenn Sie Alternativen zu Ihren Lieferanten haben, können Sie die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen verringern.
5. Bargeldreserven halten
Kleine Unternehmen sollten Bargeldreserven halten, um unerwartete Ereignisse zu überstehen. Barreserven können helfen, unerwartete Ausgaben zu decken. Dazu gehören Reparaturen, Rechtskosten oder Einkommensverluste. Als Faustregel gilt, dass Unternehmen mindestens die Ausgaben von sechs Monaten als Barreserven vorhalten sollten.
6. Aufbau starker Outsourcing-Beziehungen
Wenn Unternehmenseigentümer versuchen, alles im eigenen Haus zu erledigen, sind sie einem höheren Risiko ausgesetzt. Zum Beispiel, wenn ein wichtiges Mitglied des IT-Teams kündigt. In diesem Fall könnte das Unternehmen vor großen Sicherheitsproblemen stehen.
Bauen Sie starke Outsourcing-Beziehungen zu einem IT-Anbieter und anderen wichtigen Unterstützungsdiensten auf. Wenn den Mitarbeitern oder Systemen eines Unternehmens etwas zustößt, haben sie ein Sicherheitsnetz.
7. Prüfen Sie regelmäßig Ihre Finanzen
Inhaber kleiner Unternehmen sollten ihre Finanzen regelmäßig überprüfen. So können sie sicherstellen, dass sie ihre Ziele erreichen und mögliche Probleme frühzeitig erkennen.
Dazu gehören:
- Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben
- Erstellen und Überprüfen von Finanzberichten
- Regelmäßige Treffen mit einem Finanzberater
8. In Technologie investieren
Investitionen in Technologie können kleinen Unternehmen helfen, sich auf unerwartete Ereignisse vorzubereiten. Mit Cloud-basierter Software können Unternehmen zum Beispiel ihre Daten außerhalb des Unternehmens speichern. Dies gewährleistet, dass sie im Falle einer Naturkatastrophe oder eines Cyberangriffs sicher sind. Technologie kann Unternehmen auch helfen, Prozesse zu automatisieren. Die Automatisierung verringert das Fehlerrisiko und verbessert die Effizienz.
9. Mitarbeiter für Notfälle schulen
Kleine Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter für Notfälle schulen. So kann sichergestellt werden, dass jeder weiß, was im Falle eines unerwarteten Ereignisses zu tun ist.
Dazu gehören Schulungen für Naturkatastrophen, Cyberangriffe und andere Notfälle. Die Unternehmen sollten auch einen Plan für die Kommunikation mit den Mitarbeitern während eines Notfalls haben. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass jeder Zugang zu diesem Plan hat.
10. Halten Sie sich über die gesetzlichen Anforderungen auf dem Laufenden
Kleine Unternehmen sollten sich über die gesetzlichen Anforderungen auf dem Laufenden halten. So können sie sicherstellen, dass sie alle Gesetze und Vorschriften einhalten. Dazu gehören Steuergesetze, Arbeitsgesetze und branchenspezifische Vorschriften. Die Nichteinhaltung von Vorschriften kann zu Geldstrafen, Anwaltskosten und einer Schädigung des Rufs Ihres Unternehmens führen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kleine Unternehmen vielen Risiken ausgesetzt sind. Aber wenn sie diese Tipps befolgen, können sie sich auf das Unerwartete vorbereiten.
Verbesserung der Geschäftskontinuität und der Katastrophenvorbereitung
Machen Sie sich auf den Weg zu mehr Widerstandsfähigkeit und schützen Sie Ihre Geschäftsinteressen. Wir können Ihnen helfen, sich auf das Unerwartete vorzubereiten. Machen Sie noch heute einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch! Unsere IT-Notfallexperten von pirenjo.IT machen Ihr Unternehmen fit für alles, was da kommen mag!